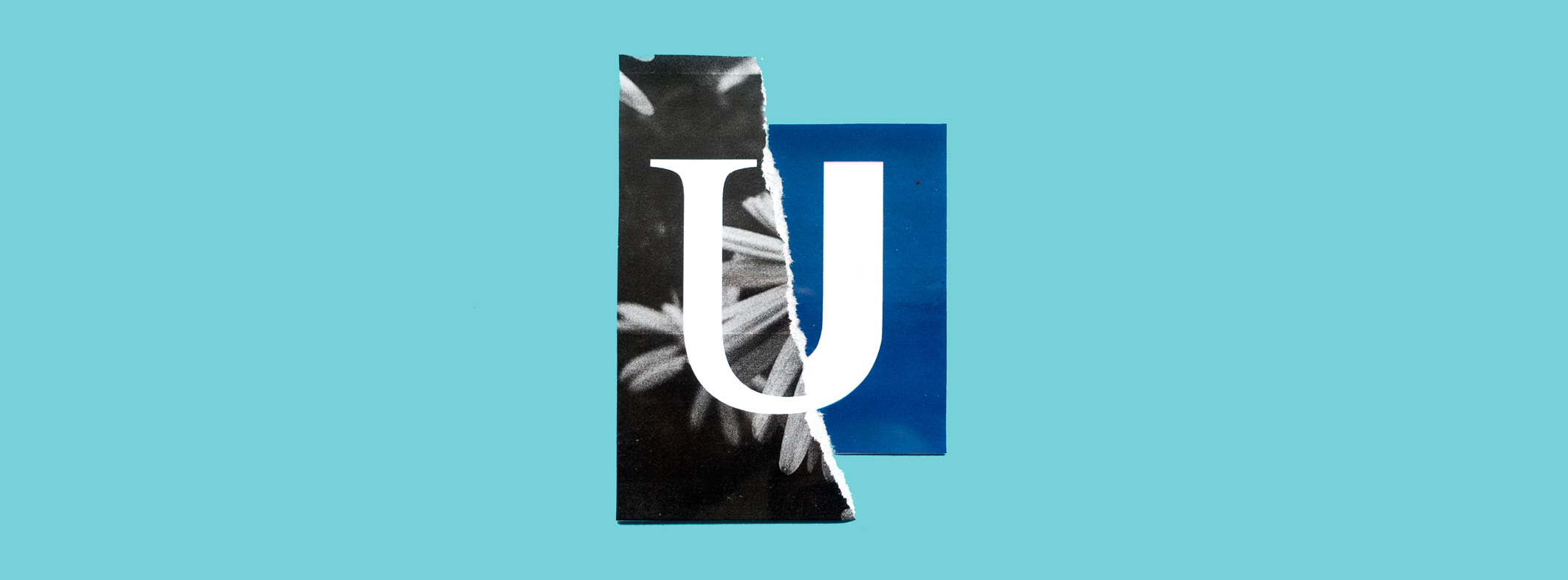
Philippe Bischof und Margrit Bürer unterhalten sich über Umbrüche im Spannungsfeld «Lokal-International» in der Kulturförderung: Gibt es tatsächlich universale Werte in unserer globalen Welt? Wie stark bestimmen die lokalen kulturpolitischen Bedingungen, was machbar ist? Und warum ist die Kulturförderung so humorlos?
Philippe Bischof: Ein U wird gewünscht, also:
Ich denke zurzeit viel über die Frage nach, was heute Universalismus bedeutet und was dies mit unserer Arbeit in der Kulturförderung zu tun hat. Wir sind auf gewisse Weise mit der ganzen Kunstwelt verbunden, zugleich ortlos und eingekapselt, und wir beobachten rundum den Verlust oder die Gefährdung von verbindenden Werten. Systeme lösen sich auf, Institutionen werden lächerlich gemacht. Und immer noch tragen wir den Mythos mit uns herum, dass die Künste, dass die Kulturschaffenden die Gegenstimmen sind, die Alternativen aufzeigen und kritisch bleiben.
Aber ist dem wirklich so? Und was ist unsere Rolle, jene der Kulturförderinnen und -förderer in diesem System, das ich selbst als zunehmend affirmativ und un-alternativ erlebe? Ohne jeglichen Pessimismus und ohne Resignation frage ich mich, was wir tun können und sollen für eine andere Zukunft, die es doch zweifellos braucht. Zumindest darin sind sich ja viele Menschen heute einig.
Wenn ich über Universalismus nachdenke, dann meine ich vor allem zweierlei: Welches sind heute die wesentlichen Werte einer offenen, diversen und konfliktfähigen demokratischen Weltgesellschaft? Und wie schaffen und erkennen wir diese Werte, bzw. wie trägt die Kunst- und Kulturwelt zu ihrer Entwicklung, Sicherung und Vermittlung bei?
In einem Buch, das ich gerade zum Thema lese, ist dieses Zitat zu finden: «Es ist nicht so, dass es keine globalen universellen Werte gäbe. Es ist eher so, dass wir weit davon entfernt sind zu wissen, worin diese Werte bestehen. Globale universelle Werte werden uns nicht gegeben; sie werden von uns geschaffen.»
Kulturmanagement habe ich immer – und in den letzten Jahren zunehmend – als Methode erlebt, die relativ kontextfrei und politbefreit den schieren Glauben an die Machbarkeit von Kulturprojekten vertritt. Dass dies nicht reicht, um Kunst- und Kulturarbeit einen tieferen Sinn, eine Wirksamkeit zu geben, haben wir wohl inzwischen erkannt – bloss frage ich mich, was wir daraus ableiten? Wie sehr sollte diese Einschätzung, wenn sie denn zutrifft, das Kultursystem beeinflussen und verändern?
Margrit Bürer: Du hast zum Auftakt eine sehr reichhaltige und dichte Gedankenfülle vorgelegt. Danke vielmals. Um mich dem Richtwert von fünf Sätzen zu nähern, beschränke ich mich auf einzelne Aspekte.
Zentral dünkt mich deine Frage, was denn die Rolle der Kulturförderinnen und Kulturförderer sein könnte, bei der Suche nach universalen Werten einer offenen, diversen und demokratischen Weltgesellschaft. Ich glaube, dass das Entwickeln und Aushandeln von Wertsystemen in einem überschaubaren unmittelbaren Umfeld geschieht und nicht auf der grossen Weltbühne, die primär Ort der Inszenierung ist. Folglich sollten wir meiner Meinung nach in der Kulturförderung wieder vermehrt auf die Stärke der föderalen Strukturen setzen, die Vielfalt und Unterschiede stärken, aber nicht die Angleichung der Fördersysteme weiter vorantreiben. Der tiefere Sinn und die Wirksamkeit der Kulturarbeit – wie du schreibst – ist im Lokalen angesiedelt und entwickelt daraus im besten Fall eine immer grösser werdende Reichweite und Kraft. Ich glaube weniger an die grossen Würfe einzelner Individuen als an die Energie des Zusammenwirkens vieler verschiedener Initiativen und Ideen.
So komme ich mit M zur Machbarkeit: Ein Kriterium, das in der Beurteilung von Kulturprojekten eine grosse Bedeutung hat. Einerseits finde ich das wichtig und wende das in meinem Alltag auch an, und anderseits zweifle ich zunehmend, ob das nicht eine Falle ist. Die Machbarkeit ist zum einen durch unser Vorstellungsvermögen begrenzt und zum anderen von einem Sicherheitsdenken getrieben. Und hat das Machbarkeitsdenken allenfalls übersteigerte Erwartungen an Kunst und Kultur zur Folge?
Philippe Bischof: Was wäre das Gegenteil von Machbarkeit? Un-Machbarkeit, Risiko, Experiment?
Ich verstehe deine Zweifel an diesem Kriterium, weil es effektiv begrenzend wirken kann und sehr affirmativ erscheint und wohl auch ist. Selbst sehe ich es aber dennoch nicht so einschränkend, da es sich für mich mehr auf einen Prozess bezieht als auf ein Ergebnis. Und ein gewisser Anteil von Machbarkeit hilft ja auch, die vielen Ideen zu filtern und in eine Priorität zu setzen.
Schwieriger finde ich die grosse Konformität mit dem System. Ich beobachte einen enormen Perfektionismus in der Ausführung, der Kunst viel ihrer möglichen Kraft nimmt.
Meinst du etwa dasselbe?
Wir wurden gebeten, über das Verhältnis «National-International» nachzudenken; B wie Berlin ist da für mich das richtige Stichwort, auch wegen meiner eigenen Biografie. Berlin ist keine Weltstadt, wage ich zu sagen, aber eine Stadt, die Welt abbildet und kosmopolitisch bzw. interkulturell aufgestellt ist; in der auch Menschen mit Migrationshintergrund Teil des Kulturlebens sind und Role Models stellen. Dieser Punkt ist für mich entscheidend, wenn es um das Verhältnis geht zwischen Nationalem und Internationalem: dass mit der Öffnung über die Grenzen auch andere Gesellschaftsgruppen, Denksysteme, Wertvorstellungen, Sprachen und Rituale Teil der Kulturwelt werden – einfach nur Englisch zu sprechen und auch noch in New York, Johannesburg, New Delhi und Tokio zu sein, bedeutet für mich relativ wenig Unterschied. Die Kunstwelt ist globalisiert, sie ist aber zugleich enorm homogenisiert – interessant wird sie dort, wo Weltbezug auch bedeutet, dass wir uns als Minderheit fühlen, die Sprache lernen müssen, die Symbole und die Deutungsverhältnisse. Berlin ist da bloss ein Anfang in Europa, aber ein guter, um uns weiter zu bewegen.
Margrit Bürer: Noch zur Machbarkeit: meine Bedenken gehen in Richtung deines letzten Satzes, dass eine Konformität damit verbunden ist und insbesondere, dass mögliche Risiken, die mit Kunst- und Kulturprojekten verbunden sind, ausgeschlossen werden.
Berlin ist eine meiner liebsten Städte. Auch wegen dem Wandel, den Berlin erfahren hat und den ich aus nächster Nähe mitbekommen habe. Ich mag die Stadt auch für die Aspekte, die du beschreibst. Berlin bietet Raum, etwas zu entdecken, zu gestalten und zu bewegen und hatte wohl darum lange eine grosse Anziehungskraft für Künstlerinnen und Künstler aus aller Welt. Berlin und Internationalität sind miteinander verflochten. Was aber nicht ausschliesst, dass in Berlin lokale Verbundenheit gesucht und gefunden wird. Das Spannungsfeld zwischen Lokal und International lässt sich überall festmachen. Die bis anhin dominierenden Zuschreibungen, dass in der Grossstadt Weltbezug vorhanden ist und auf dem Land das beschauliche Leben gepflegt wird, löst sich allmählich auf. Nicht zuletzt auch durch Künstlerinnen und Künstler, die in ihrem lokalen Umfeld neue Gestaltungsmöglichkeiten ausmachen. Und die dafür im guten Fall auf Resonanz stossen. Was macht es aus, dass ein Projekt auf Resonanz stösst? Lässt sich das überhaupt noch gezielt steuern? Meine Erfahrung aus dem kantonalen Förderumfeld ist eine ernüchternde. Die Kulturprojekte und Initiativen an den Rändern haben es weit schwieriger, in einem nationalen Umfeld wahrgenommen zu werden, als solche in den grossen städtischen Zentren. Nicht, weil sie qualitativ nicht zu überzeugen vermögen, sondern weil die Aufmerksamkeit ganz selbstverständlich in urbanen Zentren liegt und Innovation nicht ländlichen Regionen zugeschrieben wird. Aber vielleicht zeichnet sich auch hier durch die weltweite Vernetzung ein Umbruch ab …
Philippe Bischof: Ja, was heisst Resonanz heutzutage?
Ich würde gerne zurück fragen: Wieso soll Resonanz gezielt gesteuert werden? ist es nicht vielmehr ein echtes Problem unserer Kulturwelt, dass viel zu oft dieselben Zielgruppen angesprochen werden mit den sogenannt diversifizierten Angeboten? ich vermute zumindest, dass ein kräftige Prise Ungezieltheit, verbunden mit gesellschaftlich motivierter Ausdruckslust, dem ganzen System gut tun würde. Das wäre dann auch eine echte Herausforderung für Kulturmanagement und -marketing, den ganzen Machbarkeitsansspruch kritisch zu prüfen.
Im Verhältnis Stadt-Land bzw. Zentrum-Rand triffst du sicherlich einen Punkt; ich meine aber, dass dies nur der Spiegel ist derselben Problematik, die sich am Rand abzeichnet, die wir auch in der Stadt antreffen: Das Nichtpublikum wird sich etwa gleich zusammensetzen, möchte ich behaupten. Werden wir gefragt, bei wem wir mit unserer Kulturförderung Resonanz herstellen wollen, dann antworten wir in der Regel ganz pflichtbewusst: bei möglichst allen. Aber wir meinen das ja nicht wörtlich, sondern symbolisch. Wir wissen genau, und dies seit vielen Jahren und Studien, dass das «Nichtpublikum» beinahe so bewusst gepflegt wird wie das Publikum, nämlich durch inhaltliche und personelle Ausschlüsse. Mich stimmt es schon nachdenklich, wenn ich ehrlich bilanziere, wie wenig hier passiert ist in den letzten Jahren, trotz all den wertvollen und von vielen Stellen unternommenen Versuchen.
Universalismus zum zweiten, ich möchte nochmals darauf zurückkommen und dir zwei persönliche Fragen stellen:
Du bist schon sehr lange in der Kulturförderung tätig, du warst früher auch bei Pro Helvetia aktiv, du bist immer neugierig geblieben, weltoffen, und hast neue Wege gesucht, um Kulturförderung mit einem aktuellen Sinn zu versehen, und daher frage ich ganz direkt: Was wünschst du dir für die Kulturförderung der Schweiz, was erwartest du von Pro Helvetia in diesem Zusammenhang einer Weltverbundenheit? Und woher holst du bis heute deine Inspirationen?
Ich zitiere dazu noch den Autor Senthuran Varatharajah, der diesen tollen Satz gesagt hat kürzlich: „Flucht ist eine Menschheitsbewegung. Aber, fast plötzlich, wird so getan, als sei Flucht und Migration etwas Neues.“ Mich berührt das sehr, weil es die Hilf- und Ahnungslosigkeit zeigt, mit der ich mich täglich konfrontiert sehe bei solchen grossen universellen Fragen.
Margrit Bürer: Danke für deine Überlegungen zum Stichwort Resonanz. Gerne möchte ich noch kurz auf das «Nichtpublikum» eingehen. Auch mich stimmt diesbezüglich einiges nachdenklich. Ich meine, dass wir unser Augenmerk darauf ausrichten müssen, dass möglichst allen der Zugang zur Kultur offen steht (im Sinne der alten Losung von Hilmar Hoffmann «Kultur für alle») und wir dafür die nötigen Voraussetzungen schaffen. Aber es ist von uns auch zu akzeptieren, dass es Menschen gibt, die an der Kultur nicht interessiert sind. Folglich sollten wir uns auch gegen den zunehmenden Druck wehren, dass staatliche Subventionen nur gerechtfertigt sind, wenn Teilhabe rundum gewährleistet ist. Für die Kulturförderung in der Schweiz wünsche ich mir eine möglichst grosse Vielfalt, weniger Formulare und Reglementierungen, Zeit für die konkrete Auseinandersetzung mit den Projekten von Kunstschaffenden und den direkten Kontakt zu den Künstlerinnen und Künstlern. Und ich hoffe fest, dass wir auch in der Vielfalt und der Menge von Gesuchen die talentierten Kunstschaffenden und vielversprechenden Projekte erkennen – und fördern. Und weiterhin, auch wenn’s abgedroschen klingen mag: Mut zum Risiko und zu eigenständigen Entscheiden.
Von der Pro Helvetia erwarte ich, dass sich der stetige gesellschaftliche und kulturelle Wandel in ihrer Fördertätigkeit spiegelt und dabei die Verbindungen und Verwandtschaften von lokalen und globalen Entwicklungen wahrnehmbar sind.
Meine Inspiration finde ich in der täglichen handfesten Arbeit – in der Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Ansprüchen von Politik, Verwaltung, Kulturschaffenden, Publikum. Und insbesondere im Vertrauen an die Möglichkeiten der Kunst. Auch für die grossen universellen Fragen.
Anschliessend an diese Gedanken wäre beim C, dem nun ansehenden Buchstaben, „Change“ das naheliegende Stichwort. Ich greife jedoch etwas Konkretes heraus: Chorgesang. Ich staune, wie viele verschiedene Chöre es gibt, nehme mit Überraschung wahr, wer alles in einem Chor mitsingt, bin beeindruckt von der Qualität des Gesangs und der spürbaren Leidenschaft. Singen tut gut. Zweifellos. Und Singen verbindet. Überall auf der Welt.
Philippe Bischof: Singen habe ich immer bewundert und selbst nie gekonnt; nachdem ich festgestellt habe, dass es nicht am Stimmbruch lag, der mich im Singunterricht gequält hatte, habe ich mich aufs Anhören von Stimmen verlegt – und geniesse dies bis heute! Chorische Gesänge können eine unglaubliche Kraft entfalten, georgische oder türkische oder bretonische oder händel’sche.
Singen verbindet, es befreit vom Nachdenken und führt zum Empfinden, auf beiden Seiten, glaube ich. Ich erlebe Momente des Chorischen aktiv bei guten, inspirierenden Sitzungen, wenn die verschiedenen Persönlichkeiten in einen gemeinsamen Denkrhythmus einsteigen, wenn die Suche nach Wahrheit plötzlich über-persönlich wird. Das geschieht nicht jeden Tag, aber wenn es eintritt, ist es eine grossartige kulturelle Leistung.
Wie reagierst du denn eigentlich auf die heftigen Chöre eher militärischer Tonalität, mit denen im Theater immer wieder gespielt wird, von Schlief auf die Spitze getrieben, von Jelinek sprachlich aufgegriffen. Stösst dich das ab und zieht es dich an?
Du musst nicht antworten, wenn du nicht willst, denn ich muss ja das letzte Wort unseres Dialogs lancieren.
Humor statt Humus:
Ein Wort, das mich immer gestört hat in der Kulturförderung, auch wenn ich seinen Einsatz verstehe, ist das Wort Humus. Du weisst, wie es eingesetzt wird, es steht für das sehr berechtigte Anliegen, dem Nachwuchs, aber auch dem lokalen Kunstschaffen eine Wertschätzung und Beachtung zu geben, nicht nur dem überregionalen, erfolgreich ausstrahlenden. Aber es klingt zu organisch, zu pflanzlich, und tut auch zu gleichberechtigt. Denn bei aller Offenheit und Diversität ist der Umgang mit Kunst immer auch ein Umgang mit dem Einzigartigen, Herausragenden, worin sich das auch immer abbilden mag. Du hast sicherlich deine eigene Definition des Wortes?
Ein Wort, das ich hingegen oft vermisse, wenn es um Kulturförderung geht, ist Humor. Ich weiss natürlich, dass wir eine sehr ernsthafte Angelegenheit mitverantworten, in der es für sehr viele Menschen um ihre Existenz, um ihre expressive Identität geht. Und dies verdient alle erdenkliche Genauigkeit und Seriosität. Denn viele leben ja in prekären Situationen. Aber dennoch glaube ich, dass wir gerade im Umgang mit Institutionen und der Suche nach neuen oder anderen Publika, mit mehr Humor sehr viel erreichen könnten. Ich meine nicht gefällige Unterhaltung, keineswegs, sondern gewitzte, selbstironische, sarkastische Weltbetrachtung im Sinne Karl Valentins, im Sinne vieler Spoken Word Künstlerinnen und -künstler, im Sinne Sibylle Bergs und Quentin Tarantinos. Humor befreit und setzt frei, und darum geht es doch in der Kultur auch, gerade heute?
Margrit Bürer: Sehr gerne nehme ich den Ball von deinem letzten zugespielten Wort auf. Den Humus will ich nicht weiter anreichern – wenn schon, wäre mein Wort für das damit verbundene berechtigte Anliegen – die bunt wuchernde Blumenwiese, die mit ihrer Vielfalt für das ganze Ökosystem grundlegend ist. Auch eine Metapher aus der Pflanzenwelt, aber eine Freude fürs Auge und mit einer Auswahl von herausstechenden Besonderheiten.
Ja, mit Humor ist unser Berufsstand nicht überhäuft. Da stimme ich dir vollumfänglich zu. Witzig, dass du am Schluss unseres Dialogs dabei landest. Das ist doch eigentlich ein Anfang …
Wann hast du zum letzten Mal gelacht? Über was?
Angesichts der sich in den letzten Jahren häufenden männlichen Witzfiguren auf den Politbühnen der Welt könnten wir uns in der Kulturförderung u.a. auch dafür stark machen, dass der ‹klassische› Clown, der das Weltgeschehen spiegelt, uns gleichzeitig intellektuell herausfordert und sinnlich unterhält, unsere Wertschätzung und damit seine Bühne bekommt.
Der Dialog wurde per Mail im Februar 2020 geführt.